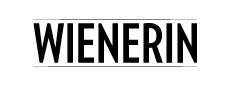Ich bin dann mal weg
Sterben. Tod. Trauer: Themen, über die wir lieber schweigen.
© Pexels/ Ksenia Chernaya
Was bei den meisten Menschen Beklemmung, Angst und Ekel hervorruft, ist für Christine Pernlochner-Kügler normaler Alltag: Als Bestatterin sieht sie dem Tod täglich ins Auge. Dennoch ist der Beruf für sie – entgegen allgemeiner Annahmen – kein trauriger. Wir haben die Innsbruckerin in ihrer Wirkungsstätte zum Gespräch getroffen.
Wie sind Sie Bestatterin geworden?
Christine Pernlochner-Kügler: Ich hatte immer Angst vor Leichen und wollte nie etwas damit zu tun haben. Bis in meine Zwanziger war der Beruf der Bestatterin für mich ein absolutes No-Go. Aber es ist ja so: Je mehr Angst man vor einem Thema hat und es von sich wegschieben möchte, desto näher rückt es – schon alleine, weil man ja immer wieder darüber nachdenkt. Ich habe eigentlich Psychologie studiert und am AZW die Themen Notfallpsychologie und Krisenintervention unterrichtet. Da kam ich erstmals mit den Themen Tod und Trauer in Kontakt und habe gemerkt, wie gut mir das tut. Meine Dissertation habe ich zum „Umgang mit Ekel in der Arbeit mit Körpern“ geschrieben, zu dieser Zeit habe ich auch meinen jetzigen Kompagnon kennengelernt, der schon während des Studiums als Konduktbegleiter gearbeitet hat. Gemeinsam haben wir Fortbildungen für Bestatter:innen angeboten und 2012 das Bestattungsunternehmen Neumair übernommen. Mittlerweile bin ich seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Wenn man mir mit 19 Jahren gesagt hätte, dass ich einmal hier landen würde, hätte ich es nicht geglaubt. Aber es macht mir jeden Tag Freude und heute kann ich mir gar nichts anderes vorstellen.
Wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag aus?
Es ist ein sehr vielfältiger Beruf – was ich auch sehr schätze, weil mir schnell fad wird. Von der Angehörigenbetreuung über administrative und logistische Aufgaben bis zur individuellen Ausrichtung von Trauerfeiern und der grafischen Gestaltung von Parten gibt es viel Verschiedenes zu tun. Mein Arbeitstag beginnt meist mit Anrufen, dass in der Nacht jemand verstorben ist. Wir müssen dann organisieren, wo und wie man die Person abholen kann, übernehmen die Koordination mit Florist:innen und Behörden und laden die Angehörigen zum Aufnahmegespräch. Dabei klären wir, wer wo und wie verstorben ist und ob es noch einmal einen Abschied braucht, weil das bisher vielleicht nicht möglich war – etwa aufgrund eines plötzlichen oder gewaltsamen Todes. Wir überlegen, welche Aufgaben wir den Angehörigen abnehmen können und welche sie selbst übernehmen möchten oder sollen, was ja für die Trauerarbeit auch wichtig ist. Ein Foto von der verstorbenen Person und beispielsweise deren Lieblingsplatz zu suchen oder die Kleidung für die Aufbahrung zu wählen, ist schon ein zentraler Teil der Auseinandersetzung mit dem Verlust. Was wir gerne abnehmen, sind lästige Behördenwege wie der Gang zum Standesamt, die Übermittlung von Dokumenten oder die Koordination mit dem Friedhof und dem Pfarrer, sofern es eine religiöse Bestattung sein soll.

Man denkt, man kommt bei uns herein und jeder ist furchtbar deprimiert. Dabei haben wir es meistens ziemlich lustig.
Bestatterin Christine Pernlochner-Kügler
Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, wenn man Bestatter:in werden möchte?
Man sollte definitiv eine hohe Belastbarkeit und Stressresistenz mitbringen. Üblicherweise ist es so, dass Menschen in Wellen sterben – eine Woche lang passiert nicht viel und dann kommt plötzlich ein Sterbefall nach dem anderen. Unser Beruf ist ja auch nicht wirklich planbar. Es ist kein Nine-to-five-Job, man muss bereit sein, auch am Wochenende, am Abend und in der Nacht zu arbeiten. Hinzu kommt, dass Angehörige anstrengend sind – sie befinden sich in einem Ausnahmezustand und sind sehr bedürftig. Gleichzeitig sind wir ja auch Dienstleister:innen, das heißt der:die Kund:in ist zwar König:in, aber man muss auch auf seine eigenen Grenzen aufpassen. Wir müssen zuhören, aushalten und auf die individuellen Bedürfnisse eingehen können, aber die Angehörigen auch ein Stückweit strukturieren können. Aber ganz grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit den Menschen meistens sehr fein, kreativ und angenehm.
Gibt es auch Momente, die Sie emotional an Ihre Grenzen bringen – bei besonderen Schicksalsschlägen etwa?
Natürlich ist man betroffen, aber man gewinnt auch relativ schnell eine professionelle Distanz. Das merke ich auch bei neuen Mitarbeiter:innen, die von aus Natur sehr mitfühlend und nah am Wasser gebaut sind, aber trotz allem im beruflichen Kontext eine erstaunliche Gefasstheit an den Tag legen. Sich darauf zu konzentrieren, was die Angehörigen brauchen, hilft dabei, die eigenen Gefühle zu regulieren. Natürlich ist das bei nahestehenden Personen etwas anderes, aber wenn man die Menschen nicht kennt, gelingt es ganz gut, eine gesunde Distanz zu wahren.

Wie hat sich Ihr eigener Umgang mit dem Thema Tod durch den Beruf verändert?
Ich habe weniger Angst davor. Natürlich hänge ich sehr am Leben und mag nicht sterben, zumindest jetzt noch nicht. Aber früher war alleine die Vorstellung, in einem Sarg zu liegen oder verbrannt zu werden, ein Gräuel für mich – ganz abgesehen von den unschönen Veränderungen am Körper, die nach dem Tod eintreten. Heute ist mir das einfach egal.
Gibt es Bestattungswünsche, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Die außergewöhnlichste Geschichte war die eines Babys, das im Alter von sieben Monaten plötzlich verstorben ist. Auf die Frage, was sie sich für die Verabschiedung wünschen würde, meinte die Mutter: „Ich möchte mit Ronja noch einmal spazieren gehen.“ Wie ermöglicht man einen letzten Spaziergang mit dem toten Kind? Wir haben dann gar nicht lange überlegt, das Kind mit Schnuller und Kuscheltieren in den Kinderwagen gelegt – es hat ganz friedlich gewirkt, als würde es schlafen – und sind mit dem Kinderwagen vom Bestattungsunternehmen zum Krematorium spaziert. Dort haben wir die kleine Ronja in den selbstbemalten Sarg gebettet und dem Feuer übergeben. Das war sicher eines der außergewöhnlichsten Erlebnisse für mich.

Sollte man sich auf den eigenen Tod vorbereiten? Und wenn ja: Wie?
Man sollte darüber nachdenken, was man selbst möchte. Will ich eine Erd- oder eine Feuerbestattung, eine weltliche oder eine kirchliche Feier? Brauche ich überhaupt eine Feier? Man darf dabei auch nicht vergessen, dass es die Nachkommen sind, die letztlich mit dem Tod leben müssen. Dass ich meine Asche in der Schweiz verstreuen lassen möchte, mag eine nette Vorstellung sein, aber manche brauchen einen bestimmten Ort, wo sie den oder die Verstorbenen „besuchen“ können. Seit drei Jahren ist es bei uns erlaubt, 20 Gramm der Asche eines Menschen zu verstreuen – das ist dann zwar eher ein symbolischer Akt, aber kann trotzdem sehr schön sein. Diese Punkte sollte man mit der Familie diskutieren und anschließend mit dem:der Bestatter:in des Vertrauens einen Termin ausmachen, wo dann auch die ersten Kosten veranschlagt werden. Entweder man legt das Geld auf einem Sparbuch an und gibt es einem vertrauten Menschen zu treuen Händen oder man schließt eine eigene Bestattungskostenversicherung ab.